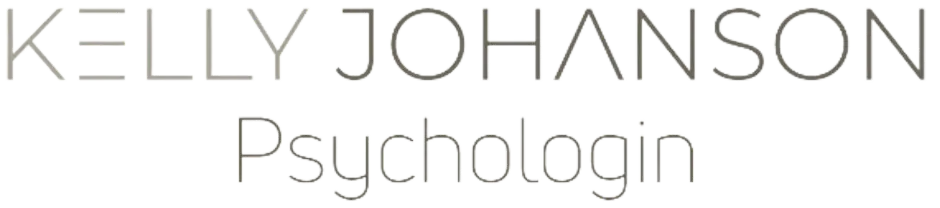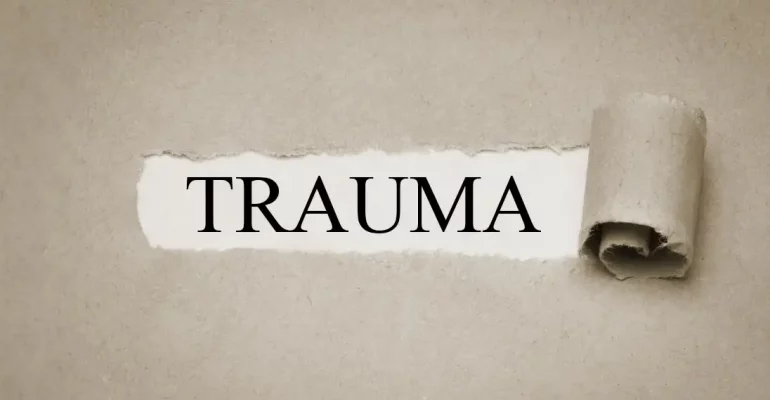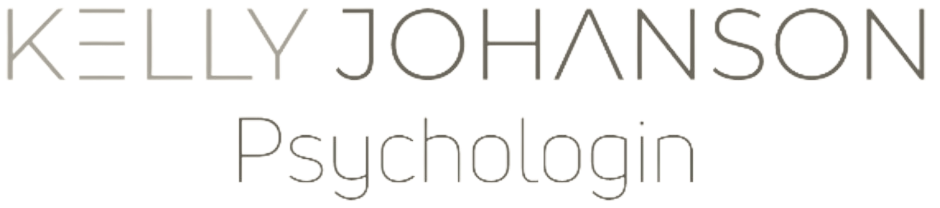Was ist Trauma und wie entsteht eine Traumatisierung?
26.02.2024 2024-08-26 19:03Mis on trauma ja kuidas tekivad trauma tagajärjed?
Trauma ist ein Teil des Lebens, ebenso wie die Heilung von Traumata.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie ein Trauma erlitten haben. Oft wird ein Vorfall verharmlost oder vor lauter Scham verdrängt.
„Trauma“ stammt aus der griechischen Sprache und bedeutet „Wunde“.
Situationen, die ein Trauma zur Folge haben können, sind solche, die eine Gefahr für das Leben und/oder die körperliche sowie psychische Unversehrtheit bedeuten.
Meist treten derartige Ereignisse unerwartet und plötzlich auf und gehen mit Gefühlen wie Angst, Hilflosigkeit, Schrecken und Ausgeliefertsein einher.
Wichtig sind vor allem zwei Gesichtspunkte: Die Person erlebt das Ereignis subjektiv als lebensbedrohlich. Das bedeutet, dass wir von außen betrachtet gar nicht wissen können, was dies im Einzelfall für eine Person bedeutet. Unsere eigene Erfahrung muss nicht zwingend der einer anderen Person entsprechen.
Der zweite Gesichtspunkt betrifft das „Nachher“: Es macht einen Unterschied, ob ein Mensch nach dem belastenden Ereignis gut versorgt wird, Personen um sich hat, die ihn beruhigen oder trösten und er genug Ressourcen zur Verfügung hat, um sich z. B. eine Auszeit oder einen Therapeuten zu leisten, ohne auf einen Therapieplatz warten zu müssen.
Dabei ist nicht das Ereignis an sich traumatisierend. Ob jemand eine Traumafolgestörung entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Alter, Häufigkeit der traumatischen Ereignisse, Selbstregulationsfähigkeit, Resilienz oder dem Vorhandensein von Bindungspersonen, die trösten und Halt geben. resilience), võimest taastuda, kohaneda ja raskustele vastu pidada ning kontakti olemasolust lähedastega, kes suudavad pakkuda tuge ja lohutust.
Man unterscheidet zwischen verschiedenen Trauma-Typen. Ein Monotrauma (akutes Trauma, Schocktrauma) resultiert aus einem plötzlichen Extremereignis mit einem eindeutigen Anfang und Ende, wie z. B. ein Verkehrsunfall, ein Diebstahl, der Tod eines geliebten Menschen oder eine Vergewaltigung. Auch die Diagnose einer schweren Krankheit kann einen Schockzustand auslösen. Bei einem Komplextrauma handelt es sich um die Folge einer Vielzahl von wiederkehrenden und andauernden Ereignissen ohne klaren Anfang oder Ende. Beispiele sind wiederholte körperliche/sexualisierte Gewalt, Folter, psychische Gewalt (z. B. ständige Demütigung) und langfristige schwere Krankheit.
Ein Entwicklungstrauma (eine Unterkategorie des komplexen Traumas) tritt in der Kindheit als Folge traumatischer Entwicklungsumstände auf. Dieses Trauma ist das Ergebnis von Vernachlässigung, verbaler und körperlicher Gewalt, (emotionalem) Missbrauch, ständigem Erleben von Gewalt und dem Zusammenleben mit psychisch kranken/traumatisierten Eltern. Es kann erhebliche Auswirkungen auf das weitere Leben haben.
Folgen von Traumata
Die Auswirkungen psychischer Traumata können sich erst Jahre später zeigen, wenn seit dem traumatischen Ereignis schon viel Zeit vergangen ist. Oft können unerklärliche Symptome auftreten, die nicht mit dem psychotraumatischen Ereignis in Verbindung gebracht werden können, da die Reaktionen der Menschen auf traumatische Erfahrungen sehr unterschiedlich sein können. Unwillkürlich und unerwartet dringen Vorstellungen und beängstigende Erinnerungen an das traumatische Ereignis ins Bewusstsein. Albträume, Schlafstörungen (Schwierigkeiten beim Einschlafen, unterbrochener Schlaf) und Symptome erhöhter Erregung (leichtes Erschrecken, erhöhte Wachsamkeit, gesteigertes Sicherheitsgefühl) sind die Folgen. Traumatisierung entsteht, wenn die Grenzen des Stressverarbeitungssystems eines Menschen überschritten wurden, Bewältigungsstrategien nicht greifen konnten und das Erleben mit Gefühlen von Ohnmacht und Kontrollverlust verbunden war. Diese Grenze ist abhängig von der individuellen psychischen Widerstandskraft (Resilienz) und Selbstregulation.
Was passiert in Gehirn und Körper in einer Gefahrensituation?
Das Notfallprogramm des Gehirns
Beim Notfallprogramm des Gehirns handelt es sich um eine automatische Reaktion des Körpers auf eine Bedrohung oder einen Stressor. Unser Körper ist darauf eingerichtet, uns so gut wie möglich vor Gefahren zu schützen. Der gesamte Körper wird dadurch in Alarmbereitschaft versetzt und ist auf die Stresssituation fokussiert. Die Amygdala (Mandelkern) – das „Alarmzentrum“ unseres Gehirns – entscheidet innerhalb weniger Sekunden, ob eine Gefahr besteht oder nicht, und schickt Informationen an das Stammhirn, damit überlebensnotwendige Energien für Kampf und Flucht zur Verfügung gestellt werden. Wir reagieren mit Herzklopfen und der Adrenalinspiegel steigt, Muskeln werden angespannt. Im Gehirn gerät dann einiges durcheinander. Unser Erleben und Handeln verändert sich sofort. Dabei werden bestimmte Hirnareale, wie zum Beispiel der präfrontale Cortex, der für logisches Denken und rationale Entscheidungen zuständig ist, vorübergehend „ausgeschaltet“. Dies kann dazu führen, dass wir in dieser Situation nicht mehr rational und überlegt handeln können, sondern eher impulsiv und instinktiv reagieren. Menschen in lebensbedrohlichen Situationen fällt es oftmals schwer, genau hinzusehen, hinzuhören, zu fühlen oder zu riechen. Wenn die Gefahr (z. B. ein Wohnungsbrand) vorüber ist, kann es passieren, dass wir uns zwar an den Brandgeruch sehr gut erinnern können, aber nicht genau daran, was und wie etwas passiert ist: ein deutliches Zeichen dafür, dass ein wesentlicher Teil unseres Gehirns, der denkende Teil, nicht mehr gut mitarbeitet. Nun handeln wir aus dem „limbischen System“, aus unseren ungefilterten Emotionen heraus. Hier wird nicht mehr überprüft oder kreativ entschieden. Hier geht es um Reaktionen aus der Angst heraus. In einer belastenden Situation sorgt das Gehirn dafür, dass in erster Linie all die Funktionen gut ablaufen, die für das Überleben notwendig sind. Wie in einem guten Team arbeiten diese Regionen zusammen und der Körper wird auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Hierzu zählt z. B., dass wir entweder schnell weglaufen können, gut kämpfen oder uns tot stellen, um nicht entdeckt zu werden. Waren Kampf oder Flucht erfolgreich, tritt nach der Anspannung eine Entspannung ein – dies ist der natürliche Rhythmus des Lebens. Wenn ein gegen etwas Ankämpfen oder eine Flucht nicht möglich sind, kommt es zu einer Art Bewegungslosigkeit/Erstarren. In diesem Modus ist man vor Angst wie gelähmt und kann nicht mehr reagieren. Man beginnt, zu dissoziieren: Teile der Wahrnehmung werden abgespalten. Das Totstellen ist quasi die letzte Notfallmaßnahme.
Dissoziation oder die Trennung von Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen ist eine Möglichkeit, traumatische Situationen zu überleben. Dissoziation als Überlebensstrategie hilft, Situationen auszuhalten, die unaushaltbar sind. Dieser Zustand (ein sehr unwirkliches Gefühl mit Erinnerungslücken, über welche die Klienten klagen) ist da, um Menschen zu schützen. Was passiert ist, kann nicht mehr bewusst verarbeitet werden. Diese Reaktion im Gehirn und im Körper schützt vor unaushaltbaren Gefühlen und Schmerzen. Das ist hilfreich, um eine Situation zu überstehen.
Die Amygdala fragmentiert das Erleben bildhaft gesprochen in einzelne „Puzzleteile“, damit sich der Körper von dem schrecklichen Geschehen distanzieren kann. Nur so ist bei Extremstress ein Überleben überhaupt möglich. Diese Reaktion kann in realen Gefahrensituationen hilfreich und lebensrettend sein (bspw. bei Opfern von Gewaltverbrechen, Unfällen und Vergewaltigung). Bei dieser Reaktion wird der Puls heruntergefahren, Denken und Schmerzempfinden werden kurzzeitig ausgeschaltet. Erinnerungen sind im Anschluss kaum oder gar nicht vorhanden. Durch die überwältigenden Gefühle kann im Gehirn (limbischen System) das traumatische Ereignis nicht als zusammenhängende Erinnerung ins biografische Langzeitgedächtnis eingespeichert werden, sondern es fliegt im Gehirn herum wie Splitter eines zerbrochenen Spiegels – ohne Kontrolle. Traumatische Erinnerungen werden dadurch in Rohform abgespeichert: Erinnerungssplitter mit verschiedenen Sinneseindrücken z. B. Geruch, Bild, Körperempfindung, Gedanke und Emotion. Bei Lebensgefahr dissoziieren wir. Dissoziation, also die Abspaltung von Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen oder Handlungen, ist eine Möglichkeit, eine traumatische Situation zu überstehen. Bei beiden Formen bleiben emotional-körperliche Erlebnisteile in der Amygdala. Bildhafte Teile werden im Hippocampus gespeichert und bilden dort eigenständige neuronale Netzwerke. Die Dissoziation während und kurz nach dem Trauma verringert die Fähigkeit des Menschen, das Erlebte zu integrieren.